Content Notes | Vorbestellen | Reziexemplar anfragen

Von oben betrachtet, sehen die anderen echt schräg aus. Ich starre auf sie herab, wie sie in der Kälte stehen, Dunstwolken ausatmen, nicht ahnend, dass sie beobachtet werden.
Neid breitet sich in mir aus. Er füllt meine Adern und verteilt sich in meinem gesamten Organismus. Gerne wäre ich wie sie. Alles egal, außer mir selbst.
Nur Schule, Volleyball, vielleicht mal ausgehen. Kino, ein bisschen knutschen auf einer Party, Alkohol und das eine Top, das so heiß aussieht.
Das Ding ist, alles hat seinen Preis. Alles. Nicht alles wird in Euro gezahlt, aber bezahlt wird es. Irgendjemand zahlt immer.
Und wenn das verflucht heiße Top nur fünf Euro kostet, dann hat sich mit ziemlicher Sicherheit irgendwo auf der anderen Seite dieser Weltkugel jemand daran die Finger wund genäht und dafür nicht mal genug Geld fürs Abendessen bekommen.
Was ist das für ein Scheiß?
Ständig tauchen Artikel in den Zeitungen auf von schlechter Tierhaltung, Krankheiten, Notschlachtungen. Das alles, damit der Burger nur ein paar Euro kostet. Aber weil ich unbedingt eine vegane Alternative möchte, bin ich unangenehm? Als sei ich das Problem. Mach dich mal locker, sieh drüber hinweg.
Trust me, I tried. Aber es hängt nun mal alles zusammen. Und anders als einen kaputten Fahrradreifen kann man diese Welt halt nicht einfach gegen eine neue, unverbrauchte austauschen. Aber ja, du Otto, schmeiß du ruhig dein Tetra Pak in die Büsche.
Verärgert knibble ich den dunklen Nagellack von meinem Daumennagel.
Den Drang unterdrückend nach draußen zu gehen und dem ignoranten Scheißarsch seinen Müll in den Rachen zu stopfen, rutsche ich von der Fensterbank und mache mich daran, ein paar der Buchkarteikarten in den Computer zu übertragen. Nach tausend Jahren ist diese Schule nun auch endlich auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen.
»Hey Lesbos!«
Ich reagiere bewusst nicht, auch wenn ich genau weiß, dass der rufende Scheißkerl mich meint. Die einzig gebührende Reaktion wäre natürlich, ihm direkt eins in seine hässliche Visage zu geben, aber das kommt weder bei der Rektorin noch bei meinen Müttern besonders gut an.
»Lesbos! Schau her, wenn ich mit dir rede, verflucht.«
Genervt speichere ich den Eintrag, schiebe die Karte zur Seite und greife nach der nächsten. Mark Hornochse Wieber, das perfekte Abziehbild von etwas, das man wohl einen blonden Surferboy nennen kann, steht in der Tür und gibt einen gellenden Pfiff von sich, der mir in den Ohren ziept und mich kurz zucken lässt.
»Na also, bist ja doch nicht taub.«
Ignorier ihn, er ist nicht da, rede ich mir beruhigend zu.
Wieber saugt mit einem nervtötenden Geräusch an seinem Trinkpäckchen, wischt sich mit der Hand über das stoppelige Gesicht. Er scheint keine Geduld mehr zu haben, denn im nächsten Augenblick klatscht sein Trinkpäckchen auf den Schreibtisch und bespritzt den Computer und mich mit Kakaotröpfchen. Ungehalten springe ich vom Stuhl auf, starre Wieber wütend an. Der steht lachend wie ein Troll da und hebt Zeige- und Mittelfinger vor den Mund wie ein V, lässt seine Zunge dazwischen hin und her schnellen.
»Verpiss dich, Wieber«, blaffe ich ihn an.
Er grinst nur wie ein Vollföhn, wartet darauf, dass ich ihm einen Grund gebe, mich weiter nerven zu können. Auch wenn er das allein durch die bloße Tatsache schafft, dass vor etwa neunzehn Jahren Herr und Frau Wieber die verhängnisvolle Entscheidung getroffen haben, kein Gummi zu benutzen.
Es läutet zur nächsten Stunde und im Gebäude verschiebt sich deutlich der Geräuschpegel. Wieber blickt kurz in den Flur, greift dann in seinen Rucksack und zieht ein Magazin hervor. »Grüß deine Muttis von mir«, sagt er und wirft es in meine Richtung. Flatternd fliegt das Magazin durch die Luft, ehe es aufgeschlagen vor meinen Füßen landet und mir eine Doppelseite mit zwei Frauen präsentiert, die nackt nicht schultaugliche Dinge machen. Lachend verschwindet Wieber im Strom der anderen Schüler*innen, die sich im Gebäude ausbreiten. Ich wende mich ab, um die Kakaosauerei aufzuwischen. Die Taschentücher werfe ich zusammen mit dem Sexmagazin in die Mülltonne.
Der Vorteil Aufsichtsperson der Schulbücherei zu sein ist, dass ich nach den Pausen etwas verspätet zum Unterricht erscheinen darf. Heute nutze ich es aus. Nachdem ich abgeschlossen habe, gehe ich nicht zum Klassenzimmer, sondern zum Schulparkplatz, auf dem Mark Wiebers Polo steht. Wie neu, natürlich von Papa und Mama bezahlt – alles für ihren kleinen Goldjungen.
Ich lasse den Schlüssel der Bücherei an meinem Finger schwingen, spaziere um das Auto herum und streichle mit der anderen Hand über den schwarzen Lack. So sauber, unberührt. Ich werfe einen Blick über die Schulter, prüfe, ob ich allein bin und bei meiner zweiten Umrundung ziehe ich statt meines Fingers den Schlüssel über den Lack des Autos. Er hinterlässt eine vollkommen perfekte helle Linie in dem bis dato unbeschadeten schwarzen Lack. Befriedigung durchströmt meinen Körper, angenehm, wie ein Sommerregen nach einem drückend heißen Tag. Erfüllt gehe ich zurück ins Gebäude.
Verdammtes Arschloch.
Im Klassenzimmer bearbeite ich den Rand meines Blockes sehr intensiv mit einem schwarzen Filzstift. Der Geruch des Stifts überdeckt ein wenig den Duft unserer Schulgefangenschaft: billiges Deo und feuchte, verbrauchte Luft.
Malen, malen, malen. Alles auf dem Papier muss dunkel werden. Alles. Paint it black. Ich spare nur die Worte aus, die meine Hausaufgaben sein sollen. Eigentlich sind sie ein wütendes Statement zur zigsten Interpretation eines Textes von irgendeinem alten weißen Mann, der schon längst von den Würmern gefressen wurde. Interpretationen, die in der Regel mit dem Kommentar ›am Thema vorbei‹ und entsprechender Note versehen werden.
Herr Rüttger schleicht durch die Reihen und teilt die Tests der letzten Stunde aus. Hier und dort hält er einen Augenblick inne, um ein-zwei Sätze zu wechseln. Aufbauende Worte,
tröstende Worte, beglückwünschende Worte. Worte, die die empfangende Person aufbauen sollen, beim nächsten Mal bessere Arbeit abzuliefern. Auch bei mir bleibt er stehen, als er den Test vor mir ablegt. Ich mache mir nicht mal die Mühe, die Seiten umzuschlagen, um nach meiner Note zu sehen.
»Luisa.«
Die Art, wie er meinen Namen sagt, reicht, um mich wissen zu lassen, dass meine Note auf keinen Fall im oberen Sechstel liegt. Es ist mir egal. Diese ganze Idee eines Schulsystems, das so veraltet ist, dass ich schreien möchte, interessiert mich einfach nicht mehr. Was nützt es mir zu wissen, was irgendein Hans-Wurst drölfzigtausend Jahre vor meiner Existenz geschrieben hat? Mit ziemlicher Sicherheit war es rassistisch, sexistisch oder beides und sollte nicht mehr nennenswert sein. Trotzdem sind die Bücher voll mit diesem und anderen Hans-Wursten und wir werden immer noch mit deren Existenz und Werken belästigt. Während derer Meinung nach, Werke von Frauen natürlich nicht relevant genug sind.
So in etwa habe ich es auch im Test formuliert.
»Luisa«, wiederholt Herr Rüttger mitfühlend, als habe ich mir das Knie aufgeschlagen. Ich blicke kurz auf, denn Autoritätspersonen neigen dazu grantig zu werden, wenn sie nicht hundertprozentige Aufmerksamkeit bekommen. Als könnte ich nicht gleichzeitig meinen Block bemalen und zuhören. Ich bin Generation Z, aufgewachsen mit täglicher Beschallung durch Fernsehen und Internet. Wenn ich eins kann, dann zuhören, während ich etwas anderes dabei tue.
»Was war denn los?«
Jetzt geht er sogar in die Knie, ist auf Augenhöhe mit mir und erwartet doch tatsächlich, dass ich ihm erkläre, was ich ihm ohnehin schon in dem Test erklärt habe. Hinter mir flüstern Natascha und Miriam sich etwas zu. Ich seufze und lege meinen Stift beiseite, damit es schneller vorbei ist.
»Nichts«, murre ich.
»Warum dann diese Art der Rebellion?«
Innerlich seufze ich noch mal. Diese Art der Rebellion. Wie er das schon sagt. Schreien möchte ich. So richtig laut schreien. Diese Art der Rebellion ist nötig, weil offenbar niemand in nennenswerter Position erkennt, dass die Lehrthemen veraltet sind. Dass diese dringend überdacht und überarbeitet gehören. Er ist Lehrer. Sollte er nicht klug sein?
»Im Grunde stimmt, was du schreibst. Trotzdem ist es keine präzise Antwort auf die Aufgabenstellung. Ihr solltet seine Lebensleistungen darlegen. Nicht ihn denunzieren.«
»Nun ja«, jetzt sehe ich Herrn Rüttger in die Augen. »Um ihn denunzieren zu können, muss man sich auskennen, oder nicht?«
Ein kaum wahrnehmbares »Uh« mischt sich in das allgemeine Gemurmel und Getuschel der Klasse. Rüttger sagt nichts. Er weiß, was kommt, und will mir keine Argumente liefern. Keine Bestätigung.
»Sie können am Text also erkennen, dass ich mich auskenne und beschäftigt habe. Dann bewerten Sie das doch einfach.« Trotzig starre ich Rüttger an.
»Luisa, du hast die Aufgabe nicht erfüllt. Ich kann ein Auge zudrücken, weil du durchaus Bescheid weißt, dich offensichtlich informiert hast. Aber das reicht nicht.«
Irgendjemand kichert. Ich richte meinen Blick wieder auf meinen Block. Starre das Schwarz an und drehe den Filzstift zwischen meinen Fingern. Ungeduldig darauf wartend, endlich mit meiner Arbeit fortzufahren.
»Du bist so klug, Luisa.« Herr Rüttgers Stimme ist leiser geworden, was mich unmittelbar zur Weißglut bringt. »Warum vergeudest du das?«
»Das tue ich nicht«, presse ich hervor.
Herr Rüttger hockt noch einen Moment vor mir, als warte er auf eine Entschuldigung oder ein demütiges Versprechen nach Besserung. Was er natürlich nicht bekommt. Er erhebt sich und ich glaube ihn seufzen zu hören.
»Das muss unterschrieben werden«, sagt er und tippt mit dem Finger auf meinen Test, ehe er weiter durch die Reihen schleicht.
»Meinetwegen«, brumme ich leise, schiebe den Test beiseite und kann endlich weiter die Schwärze auf meinem Block verteilen.

Es ist erstaunlich, wie viel man hört, wenn man einfach mal still daliegt. Schritte auf dem Flur, ein Stuhlscharren, Gelächter einer gesamten Klasse, wenn die Fenster offen sind, manchmal sogar das Pfeifen und Rufen aus der Sporthalle. So viel Bewegung um mich herum. Um mich, die regungslos auf einem Tisch in der Schulbücherei liegt. Versteckt zwischen den Regalen mit den Büchern U bis W. Träge das Leben aushaltend. Das mache ich manchmal. Stunden schwänzen und mich in einer Art Lethargie aus dieser Welt wegdenken. Versuchen zu vergessen, dass sie existiert und dass ich existiere. Einfach nur sein, ohne sich zu vergegenwärtigen, warum man überhaupt ist und alles so wenig Sinn ergibt.
Irgendwie beruhigt es mich, das stille Liegen in einem Gebäude, in dem so viel los ist und so vieles gleichzeitig passiert.
Als es läutet, verändern sich die Geräusche. Aus dem bisher gelegentlichen Stuhlscharren wird ein ganzer Chor und durch die Flure schwappen Schritte und Gespräche.
Es dauert eine ganze Weile, bis das Schuhgetrappel, Stühlerücken, Rufen und Pfeifen abebbt. Alle eilen sie aus der Schule, um nach Hause zu kommen. Aber ich habe keine Lust heimzugehen. Nicht, weil ich nicht gerne dort bin, sondern weil ich mich nicht aufraffen kann, mich auf den Weg zu machen. Nicht einmal mich aufzusetzen, scheint mir in diesem Moment eine machbare Aufgabe zu sein.
Würde es überhaupt jemand merken, wenn ich über Nacht hierbliebe?
Also klar, meine Mütter, weil ich nicht nach Hause käme. Aber überprüft irgendjemand, ob alle das Gebäude verlassen haben, ehe jemand die Türen abschließt?
Vielleicht bleibe ich heute einfach liegen, um es herauszufinden.
In meine Überlegungen versunken, fallen mir die Schritte erst kaum auf. Lauter werdend, scheinen sie im Flur, direkt vor der Bücherei zu sein. Ich atme so leise ich kann, weil ich mir einbilde, man könne mich vor der Tür sonst vielleicht hören und entdecken. Und darauf habe ich gerade keine Lust. Im nächsten Moment wird die Tür der Bücherei aufgestoßen. So grob und untypisch, dass ich mit einem Mal aufrecht sitze. Ich rutsche vom Tisch, um nachzusehen, wer reingekommen ist, da entdecke ich sein hämisches Grinsen schon durch eins der Regale hindurch.
Das gefällige Geräusch, das Wieber macht, als er mich entdeckt, lässt alles in mir Alarm schlagen.
»Dumme Schlampe.« Es sind nur einige wenige Schritte, um aus dem versteckten Winkel der Bücherei zur Tür zu gelangen, aber Wieber ist so schnell, dass ich keine Chance habe. Ohne weitere Vorwarnung werde ich geschubst und stolpere gegen die Wand.
Ich wusste, dass der Kratzer am Auto ihn aufregen würde, aber dass es ihn so in Rage versetzt, mich sogar körperlich anzugreifen, damit habe ich nicht gerechnet.
»Was soll der Scheiß?« Wäre Wieber eine Comicfigur, wäre sein Kopf jetzt blutrot und Rauch würde davon aufsteigen. Seine Halsschlagader pulsiert so sehr, dass sich sogar der Kragen seines Lacoste-Shirts bewegt.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, entgegne ich bloß, straffe die Schultern und will mich an ihm vorbei zwängen. Er packt mich am Arm. So fest, dass ich glaube, er will ihn mir brechen. Ich winde mich, versuche mich von ihm loszumachen. »Verpiss dich, Wieber.«
»Du dumme Schlampe hast mein Auto zerkratzt!«
»Du hast da sicherlich stichhaltige Beweise. Lass das doch einfach deinen Daddy und seine Anwälte klären.« Ich weiß, dass es Wieber auf die Palme bringt, wenn man tut, als löse er all seine Probleme mithilfe seines Vaters. Dabei tut er genau das. Immer wieder. Papi rufen, wenn er Mist gebaut hat, damit Papi alles wiedergutmacht. Ein Lächeln huscht mir über die Lippen. Vermutlich nicht der beste Moment, keine Kontrolle über die eigenen Impulse zu haben.
»Du kleine Drecksschlampe meinst, du kannst dich hier aufführen, wie du willst. Ich werd’ dir schon zeigen, wo du hingehörst.« Wiebers Mund ist ekelerregend nah an meinem Gesicht und obwohl ich es versuche, kann ich mich einfach nicht von ihm befreien.
»Aber wie sollst du das auch lernen, ohne Mann im Haus?« Wieber spuckt neben mir auf den Boden. »Euch Lesben gehört es echt mal eingeprügelt.« Er schiebt mich nach hinten, zurück in den versteckten Winkel, bis meine Hüfte schmerzhaft gegen die Tischplatte gedrückt wird, die bis eben noch meine rettende Insel war.
»Lass mich los«, zische ich grimmig. Stattdessen packt Wieber mit der anderen Hand mein Gesicht. Drückt mit Daumen und Zeigefinger meine Wangen zusammen. Mit einem Kopfschütteln versuche ich ihn abzuwimmeln, aber er greift nur fester zu. Ich befürchte, meine Backenzähne brechen jeden Moment aus meinem Kiefer.
»So was kann passieren, wenn man das Eigentum von anderen Leuten beschädigt.«
Wiebers Gesicht verzieht sich zu einer grinsenden Grimasse
und er genießt es sichtlich, Macht über mich zu haben. Das reicht. Voller Wucht ramme ich ihm mein Knie in den Schritt. Er stöhnt entsetzt auf und ich nutze den Moment, schubse ihn weg von mir und eile auf die Tür zu.
Aber er ist sofort hinter mir, packt mich bei meinen langen Haaren. Glühender Schmerz, der sich über meine Kopfhaut zieht und mir Tränen in die Augen treibt. Notgedrungen lande ich in einer beinahe knienden Haltung vor Wieber auf dem Boden. Ich wehre mich, kann ihn aus meiner
Position jedoch nicht richtig erwischen. Kratze ihn aber an der Hand. Er zischt eine Beleidigung und im nächsten Moment reißt er mich herum und knallt mir seine Faust ins Gesicht. Explosionsartig nimmt es mir Sicht und Atem. Meine Lippe wird heiß und ich schmecke Blut. Ehe ich mich von dem Schlag gefangen habe, stößt Wieber mich von sich weg und ich lande unvorbereitet auf dem rauen Teppichboden der Bücherei. Der Geruch von jahrzehntealtem Staub stößt mir in die Nase und vermischt sich mit dem Geruch von meinem Blut.
»Ich hoffe, du verdammte Schlampe hast nun endlich verstanden, wo du hingehörst.«
Als ich versuche, mich aufzuraffen, bekomme ich einen Tritt in den Bauch und sacke zurück auf den Boden. Ich kann nicht atmen. Kann mich nicht bewegen, obwohl alles in mir vor Wut tobt und ich Mark Wieber die Arroganz aus dem Gesicht reißen möchte. Der Schmerz nimmt mir die Kontrolle über meinen Körper. Ich liege da, schnaufend, konzentriert darauf, Luft zu bekommen. Starre mit tränenverschmiertem Blick hoch zu Wieber. Wieder spuckt er, trifft dieses Mal mein Gesicht.
»Pass auf, mit wem du dich anlegst, Fotze. Beim nächsten
Mal überlebst du es vielleicht nicht.« Erneut trifft sein Fuß meinen Körper. Dieses Mal meine Hüfte. Damit lässt er mich liegen und verlässt die Bücherei. Die Stille, die mir eben noch Geborgenheit geschenkt hat, wirkt nun bedrohlich und kalt.
Aufstehen erscheint mir unmöglich. Ich liege geschafft auf dem grauen Teppich, der an meiner Wange kratzt und nach beklemmendem Mief stinkt. Meine Sicht ist getrübt von Tränen, die mir warm über die Haut laufen, ehe sie in den Teppich sickern. Ich schluchze und mein Rotz vermischt sich mit dem Blut meiner Lippe. Es brennt. Mein ganzer Körper brennt. Vor Schmerz, vor Wut, vor Demütigung.
Ich bewege mich nicht. Wenn ich still liege, muss ich mich nie wieder mit dem Schmerz dieser Welt, meinem Schmerz, beschäftigen. Zeit spielt keine Rolle mehr für mich. Es ist mir egal. Alles ist egal. Tränen und Blut kleben an meiner Haut. Lassen sie jucken und spröde anfühlen. Mein Blick geht ins Leere, ohne dass ich etwas wahrnehme.
Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass Leute grundlos einen Obdachlosen anzündeten. Mama hat von einem Bauern im Nachbarort erzählt, der einen Wurf Katzen in einer Tüte ersticken ließ, weil er sie nicht gebrauchen konnte. Menschen bringen andere Menschen um, wegen Geld oder Schmuck oder einfach, weil sie es können. Und trotzdem erwartet jeder von mir, dass ich durch diese Welt gehe, als
sei sie nicht komplett verkommen und kaputt. Als steckten wir alle nicht in dieser Suppe aus Schlechtigkeiten fest. Außer man gehört zur Familie Kardashian, Trump oder den Wiebers. Mit all dem Geld auf dem Konto und ohne auch nur das kleinste Stück Gewissen, lässt es sich vermutlich ganz gut aushalten.
Meine Augen brennen vom Starren und Weinen, darum blinzle ich einige Male. Mein Blick klärt sich und ich erkenne, was ich die ganze Zeit angestarrt habe.
Ein schwarzes Buch, das hinter dem Bücherregal an die Wand geklemmt ist. Nur sichtbar, wenn man am Boden liegt.
Ist es dahinter gerutscht? Es wirkt eher, als sei es versteckt worden.
Ich ziehe die Nase hoch, fahre mir vorsichtig mit dem Ärmel durchs Gesicht. Das Jucken der Tränenflüssigkeit auf der Haut lässt nach, wird durch Schmerz abgelöst, als ich die Stelle berühre, auf die Wieber mich geschlagen hat. Mir entfährt ein Zischen und kurz presse ich die Augen zusammen. Fokussiere mich dann aber wieder auf das versteckte Buch und schiebe meinen schmerzenden Körper über den Teppichboden. Näher an das Regal, bis ich direkt davor liege und die Ecke vom Buch genauer sehen kann. Ein schwarzes Notizbuch, keins der Ausleihbücher. Langweilig in seiner Erscheinung, interessant nur durch die Tatsache, dass es hier versteckt ist.
Ich will es hinter dem Regal hervorziehen. Aber es steckt fest. Der Winkel passt nicht. Jemand hat sich viel Mühe gemacht, das Buch hinter dem Regal festzuklemmen.
Stöhnend setze ich mich auf. Ziehe ein Buch nach dem anderen aus dem Regal. Lege sie achtlos neben mich, bis das Notizbuch frei und besser zu greifen ist. Doch das Bücherregal ist so fest dagegen gedrückt, dass sich das Buch nicht rührt. Verdammt noch mal.
Gaarder, Gaiman, Gier, Goethe, Golding, Grimm – alle landen sie auf dem Boden, bis das Regal G so gut wie leer ist und ich es ein Stück von der Wand wegziehen kann.
Mit einem dumpfen Laut landet das Notizbuch auf dem Teppich. Auf der ersten Seite ist fast alles mit schwarzem Filzstift ausgemalt worden. Die Stellen, die ausgelassen wurden, bilden Buchstaben. Kunstvoll verschnörkelte Buchstaben.
»Welcome to my Ghost World«, begrüßen sie mich.
Irgendwo fällt eine Tür ins Schloss und ich schrecke auf.
Auf keinen Fall will ich hier in der Bücherei zwischen all den Büchern, die ich auf den Boden geworfen habe, gefunden werden. Noch weniger will ich, dass jemand sieht, wie Wieber mich zugerichtet hat. Ich schiebe das Buch in meine Tasche und werfe sie über die Schulter. An der Tür hole ich tief Luft, ehe ich vorsichtig einen Blick in den Flur werfe. Niemand da, also nichts wie weg.
Es ist lächerlich. Für gewöhnlich höre ich auf meinem Weg nach Hause Musik. Heute nicht. Stattdessen lausche ich auf auffällige Geräusche, die einen möglichen Angriff ankündigen. Hab’ mich nicht mal getraut meinen üblichen Weg, am alten Bahnhof vorbei, zu gehen. Nehme lieber die belebteren Straßen. Ständig drehe ich mich um, überprüfe, dass mir niemand folgt. In meinem Magen rumort es vor Unwohlsein und ich muss mir eingestehen, dass ich Angst vor Wieber habe. Sofort brennt meine Kopfhaut wieder, als ich daran denke, wie er mich an den Haaren gepackt und daran gezerrt hat. Verdammtes Arschloch.
Ich ziehe meinen Schlüsselbund aus der Hosentasche. Lasse es wie ein Säckchen mit klimperndem Gold in meine rechte Hand fallen und schließe meine Faust darum. Was stand noch mal im Internet? Die Schlüssel zwischen die Finger oder lieber nicht? Ach, Mist.
Ein Schauer läuft mir über den Rücken, weil ich das Gefühl habe beobachtet zu werden. Ich blicke mich um, entdecke aber niemanden. Der Nachmittag ist kühl und feucht und kaum jemand ist unterwegs. Trotzdem. Immer wieder kommt es mir vor, als starre mich jemand an. Ich muss einfach schneller gehen. Schneller zu Hause ankommen. Aber mein Tempo sorgt dafür, dass der Tritt, den ich in den Bauch bekommen habe, wieder deutlicher zu spüren ist. Ich schnaufe und atme gegen das Ziehen, wie gegen die Krämpfe während der Periode.
Meine Schritte werden langsamer, als ich am Ende der Straße einen geparkten schwarzen Polo sehe. Zögere, bin kurz davor, stehenzubleiben. Überlege, ob ich die Straßenseite wechseln und einen anderen Weg nach Hause nehmen soll. Sehe mich um, ob jemand in der Nähe ist. Personen, die es bezeugen können, falls mir etwas passiert. Für den Fall der Fälle. Aber die Straßen sind wie ausgestorben bei dem Wetter und auch der Wagen wirkt verlassen. Trotzdem … vielleicht besser auf die andere Straßenseite.
Ich habe zwei Schritte in Richtung der Straße gemacht, als ich doch stehen bleibe.
Nein! Dieses verdammte Arschloch wird nicht dafür sorgen, dass ich mir vor Angst in die Hose mache. Ich knete den Schlüsselbund und ziehe Kraft aus dem berauschenden Gefühl, das ich hatte, als ich sein Auto zerkratzt habe. Ich ändere meine Richtung erneut und gehe geradeaus, direkt auf den Polo zu. Für jeden Schlag, jeden Tritt, jedes Haareziehen, wird sein Polo einen Kratzer bekommen. Für jede Beleidigung und jedes Spucken.
Soll er mich doch auf offener Straße angreifen. Meine Ma wird ihn in Grund und Boden klagen.
Nach ein paar weiteren Schritten erkenne ich einen »Kim an Bord«-Sticker auf dem Heck und atme langsam aus. Es ist nicht Wiebers Wagen.
In mir tobt eine Mischung aus Scham und tiefem Zorn. Ich bin wütend, dass Wieber trotz seiner Abwesenheit gerade so viel Macht über mich hatte.

Ich atme frustriert aus, als ich sehe, dass in unserer Küche bereits Licht brennt. Mama ist schon zu Hause. Eigentlich kein Wunder, dass sie vor mir da ist, ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um nach Hause zu kommen. Auf keinen Fall darf sie mich sehen, ehe ich mich waschen konnte.
So leise ich kann, schiebe ich den Schlüssel in das Schloss und öffne die Tür. Der Geruch von gebratenen Zwiebeln begrüßt mich, zusammen mit Buster.
»Psst«, beruhige ich ihn und streichle sein langes, braunes Fell, während ich ihn zurück ins Haus dränge. Aber es nützt nichts, er freut sich zu sehr, dass ich da bin und springt aufgeregt um mich herum. Seine Krallen auf den Fliesen sind kaum zu überhören, obwohl in der Küche die Zwiebeln in der Pfanne zischen.
»Hallo Süße. Da bist du ja endlich«, ruft Mama aus der Küche. »Zwei Hände mehr, um Falafel zu rollen.«
»Muss eben aufs Klo«, lüge ich und eile die Treppe hoch ins obere Bad. Ich brauche einen Moment, ehe ich den Blick in den Spiegel wage.
Meine Mascara ist verlaufen und ich habe trotz des Abwischens mit meinem Ärmel noch immer Blut am Kinn. Meine Oberlippe ist aufgeplatzt und dick. Vorsichtig berühre ich sie mit der Fingerspitze, ziehe meine Hand aber sofort zurück, weil es höllisch zieht. Ich wage einen Versuch zu lächeln, lasse es aber sofort wieder.
Ich ziehe mein Shirt aus der Hose. Auf meinem Bauch hat sich bereits ein leicht violetter Schatten gebildet, dort, wo Wiebers Fuß mich getroffen hat. Es schmerzt, wenn ich drücke, aber nicht so schlimm wie meine Lippe. Ein Glück, dass meine Wange sich nicht genauso verfärbt.
Geschafft setze ich mich auf den Toilettendeckel. Reibe die Schminke und das restliche Blut mit ein paar Feuchttüchern ab und wünschte, ich könnte auch ein wenig von dem schalen Gefühl in mir damit wegwischen. Klappt natürlich nicht.
Wütend pfeffere ich die dreckigen Tücher in den Mülleimer und betrachte mein Gesicht erneut im Spiegel. Besser, aber die kaputte Lippe wird Mama nicht übersehen.
Die meiste Zeit ist es sehr ätzend, eine Frau zu sein. Ständig wird man bevormundet oder nicht für voll genommen oder sonst für unklug oder weniger wert verkauft. An Tagen wie heute, wo ein Arschloch wie Mark Wieber mir zeigen will, wo mein Platz in der Welt ist, da hasse ich es noch mehr. Ich streiche mir über den Kopf und merke, dass auch meine Kopfhaut sich wund anfühlt. Genau wie meine Seele.
Hätte er mich überhaupt so zurichten können, wenn er mich nicht bei den langen Haaren gepackt hätte?
Ich halte meine Haare zusammen, als wollte ich mir einen Pferdeschwanz binden.
Auch nicht besser, den kann man ja noch gezielter greifen.
Als ich meine Haare loslasse, fallen sie mir wieder über die Schultern. Träge und kraftlos.
Erneut greife ich sie, wickle sie auf, als wollte ich einen Dutt machen. Weniger einladend als der Pferdeschwanz, aber keineswegs befriedigend. Wieder fallen die Haare über meine Schultern. Völlig nutzlos. Außer für Wieber.
Aus der Schublade des Badezimmerschranks ziehe ich eine der Haarscheren von Mama. Lasse sie ein paar Mal auf und zu gleiten und lausche dem metallisch schabenden Geräusch.
Mein Blick fällt auf meine Adern am linken Handgelenk. Sie treten heute besonders blau auf meiner blassen Haut hervor. Mit der Spitze der Schere ziehe ich die Adern nach. Erst leicht, dann etwas fester und noch etwas fester. Auf meiner Haut bleiben rote Striemen zurück. Wie feste ich wohl drücken müsste, damit es blutet? Manchmal frage ich mich, ob es besser wäre, es einfach zu beenden. Sich nicht mehr mit all diesem ganzen Scheiß herumzuschlagen. Aber dann befürchte ich, dass das alles vielleicht nur von noch viel größerer Scheiße abgelöst wird und die Überlegungen verfliegen wieder.
Entschlossen packe ich meine Haare und schneide Strähne für Strähne ab. Wie gefallene Engel gleiten sie ins Waschbecken und auf den Boden. Lassen sich dort nieder und verdunkeln die hellen Fliesen.
Die linke Hälfte meines Kopfs sieht aus wie ein gerupftes Huhn, als ich wieder zu so was wie Verstand komme und begreife, was ich gerade getan habe. Mir schießen Tränen in die Augen und mit einem Mal erschlägt mich das Elend, das ich in den letzten Stunden zu ignorieren versucht habe.
»Mama«, jaule ich und schließe die Badezimmertür auf. »Mama, kannst du mir helfen?«, rufe ich den Flur runter und kann das Schluchzen kaum unterdrücken.
»Was ist denn, Lulu?«, ruft Mama besorgt, eilt aber bereits die Treppe hoch. Mit aufgerissenen Augen starrt sie mich an.
»Was ist passiert?«, fragt sie erschrocken.
Beschämt schaue ich zu Boden. Halte es nicht aus, sie anzusehen, wenn ich mich so elendig fühle.
»Was ist mit deiner Lippe passiert?«, fragt Mama und steht nun neben mir. Die Hände an meinen Schultern, um mich zu halten.
»Hab’ mich geprügelt«, lüge ich.
»Lulu«, sagt Mama. Ihre Hand liegt nun an meiner Wange und sie versucht mich mit sanftem Druck dazu zu bringen, sie anzusehen. Keine Chance.
»Und deine Haare?«
Ich wische meine Tränen und ihre Hand weg. »Die sind ein Nachteil beim Kämpfen.«
»Ach, Lulu«, sagt Mama und nimmt mich in den Arm. Ich stütze mich dankbar gegen sie und lasse es zu, dass sie mich tröstet.
Ma wird mich später vermutlich nicht so leicht ohne Erklärungen davonkommen lassen.
»Kurzhaarfrisuren sind aktuell ja sehr im Trend«, sagt Mama leise und ich kann hören, dass sie lächelt, versucht mich aufzubauen. Ich schaue sie endlich an.
»Es soll einfach nur nicht mehr so aussehen, als sei ich durchgedreht und mit dem Kopf zuerst in einen Mähdrescher gesprungen.«
»Nichts leichter als das«, sagt Mama und lotst mich in Richtung Treppe. »Unten ist das Licht besser.« Aber mir entgeht nicht, dass sie einen Blick ins Badezimmer wirft, um vielleicht herauszufinden, was wirklich vorgefallen ist.
Der Esszimmerboden ist voller Haare. Mama hat Buster in den Flur geschickt, weil er ständig zu mir wollte, die Haare aufgewirbelt hat und ihr im Weg rumstand. Mein Kopf sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Unfall, sondern wie die Kopie eines coolen Miley-Cyrus-Kurzhaarschnitts. An den Seiten kurz rasiert, oben etwas länger. Aber nicht so lang, dass man sich darin besonders gut festgreifen könnte.
»Gefällt’s dir?«, fragt Mama und hält zwei ihrer Spiegel so hoch, dass ich den Haarschnitt von allen Seiten begutachten kann. Ich lege nicht viel Wert auf diese Sachen. Klamotten, Frisuren, Make-up. Aber ich weiß, dass Mama sich sehr bemüht, mich nicht die ganze Zeit auszufragen, was passiert ist, darum schenke ich ihr ein strahlendes, wenn auch schmerzendes, Lächeln.
»Ganz wunderbar«, sage ich und fahre mir mit der Hand durch das ungewohnt kurze Haar.
»Dein Glück, dass du zufällig eine Friseurmeisterin zur Mutter hast«, sagt Mama, posiert gespielt eingebildet. Tut so, als würde sie ihren blonden Kurzbob richten und macht dabei kurz ein Duckface als würde sie für eine Kamera
posieren. »Dafür hast du heute Kehrdienst.«
»Ich nehme an, dieses Mal werde ich nicht dafür bezahlt?«
Als ich jünger war, hatte ich regelmäßig Kehrdienst in ihrem Salon, um mein Taschengeld aufzubessern. Aber für was soll man sein Geld schon ausgeben, wenn die Welt ohnehin vor die Hunde geht? Darum habe ich das schon ewig nicht mehr gemacht.
»Einen Cent für deine Gedanken«, entgegnet Mama und packt ihre Utensilien zurück in die Tasche.
»Du willst mich dafür bezahlen, dass ich dir erzähle, was passiert ist?«
»Wenn es hilft, dass du mit uns sprichst«, sagt Mama und versucht ihre Besorgnis hinter einem unschuldigen Lächeln zu verbergen.
»Nicht weiter der Rede wert«, sage ich seufzend und hole den Besen.
»Das wird deine Ma gleich anders sehen«, triezt mich Mama.
»Vielleicht fällt es ihr ja nicht auf«, entgegne ich hoffnungsvoll und Mama lacht schallend.
»Von schulterlang auf Kurzhaarschnitt. Cami ist manchmal noch sehr mit dem Kopf bei der Arbeit, wenn sie heimkommt, aber das wird selbst ihr auffallen.«
Ich verziehe schmollend den Mund, während ich die Haare zusammenfege. Sofort zieht mir wieder der Schmerz durchs Gesicht und lässt mich stöhnen.
»Vielleicht sollte da etwas Eis drauf«, schlägt Mama vor und ihr gerade noch heiteres Gesicht wird wieder durch das mit der Sorgenfalte auf der Stirn abgelöst.
»Geht schon«, sag ich und fege den Haarberg auf ein Kehrblech.
»Was ist mit dir passiert?« Ma fixiert mich mit ihren blauen Augen. Kommt auf mich zu.
Ich sitze auf der Couch und blättere in einer Graphic Novel. »Hatte Lust auf einen neuen Look«, sage ich, ohne aufzusehen. Sie legt ihre Hand unter mein Kinn. Mit sanfter Strenge zwingt sie mich, sie anzusehen.
»Ich meine nicht deine Haare, ich meine das da.« Mit der anderen Hand deutet sie in mein Gesicht und meint wohl meine dicke Lippe.
»Nicht so schlimm«, sage ich und ziehe mein Kinn aus ihrem Griff.
»Wer war das?«, fragt sie besorgt und setzt sich neben mich auf das Sofa. Buster legt seinen Kopf auf ihr Bein, erwartet, dass sie ihn streichelt, aber sie ist voll und ganz auf mich konzentriert. Sie wird mich nicht so einfach ohne Erklärung davonkommen lassen wie Mama.
»Ist nicht weiter schlimm«, wiederhole ich und lächle vorsichtig, weil das immer noch höllisch weh tut.
Ma schließt kurz ihre Augen und wirkt traurig. »Ist das wieder wegen uns passiert?« Ihre Stimme klingt dünner als sonst. Sofort habe ich einen Kloß im Hals.
»Spielt doch keine Rolle«, entgegne ich und versuche, taff zu klingen. Ich öffne wieder meine Graphic Novel und konzentriere mich sehr auf die Farben und die Linienführung der Zeichnungen. Es bricht mir das Herz, das alles. Ich weiß, dass meine Mütter es nicht leicht hatten. Und es noch heute oft an ihnen zerrt, dass die Gesellschaft sie nicht akzeptieren kann. Mas Familie redet überhaupt nicht mehr mit ihr, seit sie wissen, dass sie Frauen liebt. Ich weiß nicht viel darüber, aber Mama hat mal erzählt, dass es Ma trotz all der Zeit immer noch sehr verletzt.
Dass ihre Tochter in der Schule eine dicke Lippe bekommt, weil sie zwei Mütter hat, streut Salz in dieselbe Wunde.
»Ach«, sagt sie seufzend und zieht mich an sich, für eine seitliche Umarmung. Ich lasse die Graphic Novel wieder in meinen Schoß gleiten und halte ihren Arm mit meinen Händen. Wir wissen beide, dass es für dieses Problem erst mal keine Lösung gibt. Aber es ist schön, dass wir uns haben.
»Soll ich ihm die Hölle heiß machen?«
Jemandem die Hölle heiß machen ist Mas Leidenschaft, deswegen ist sie Anwältin geworden. Ich muss schlucken, denn eine Sache muss ich ihr nun doch beichten.
»Du wirst mir gleich die Hölle heiß machen«, gestehe ich und obwohl sie sich anders hinsetzt, damit sie mich ansehen kann, starre ich auf meine Knie und vermeide Augenkontakt.
»Los, raus damit«, fordert sie.
»Es könnte sein, dass ich ein Auto zerkratzt habe.«
Ma lacht auf. Kein freudiges, amüsiertes Lachen, sondern ein das-darf-doch-jetzt-nicht-wahr-sein-Lachen. »Es könnte sein?«, hakt sie nach.
Ich nicke und mache mich gefasst auf die Standpauke. Aber Ma atmet nur tief aus, fährt mit der Hand durch ihre dunklen, kurzen Haare. Dann zieht sie mich wieder an sich.
»Ich hoffe, das war die dicke Lippe wert«, sagt sie und ich bin ehrlich überrascht, dass sie mich so ohne Weiteres damit davonkommen lässt.
»Danke«, flüstere ich und lege meinen Kopf an ihre Schulter. Beobachte Buster, der vor der Couch liegt, seinen Kopf auf Mas Fuß abgelegt hat und zu uns hochblickt, als sei er neidisch, dass er nicht Teil der Umarmung ist.
»Und warum der Haarschnitt?« Ma flüstert jetzt. Das ist diese Sache zwischen uns, wenn wir über Dinge reden, die zu groß erscheinen. Dann flüstern wir.
Mama ist oben, außer Hörweite, darum antworte ich leise: »Dann kann man mich bei einem Angriff nicht mehr so gut packen.«
Ma seufzt und ich höre sie Schlucken. »Wir müssen das der Schulleitung melden.«
»Nein«, sage ich bestimmt, aber noch immer flüsternd. »Es wird dann nur noch schlimmer.«
Erneut ein Seufzen von Ma. Sie streicht mir über den Kopf, was sich wegen des neuen Haarschnitts ungewohnt anfühlt.
»Oh, meine kleine Kämpferin«, sagt sie.
»Bist du sauer?«, frage ich wieder in normaler Lautstärke.
Ich kann spüren, dass sie den Kopf schüttelt. »Nein, ich bin nicht sauer.«
»Aber enttäuscht.«
Es dauert zwei Herzschläge, bis sie antwortet, und ich habe Angst, dass sie Ja sagt.
»Ich bin stolz auf dich.«
Verwirrt löse ich mich von ihr, um sie ansehen zu können.
»Weil ich ein Auto zerkratzt habe?«, frage ich perplex.
Ma lacht. »Oh, nein, auf keinen Fall. Darüber reden wir noch.« Dann nimmt sie meine Hand. »Ich bin stolz, dass du dir nichts gefallen lässt. Dass du so kämpferisch bist und für das einstehst, woran du glaubst.«
Ich rümpfe ein wenig die Nase. Zum einen, weil ich es unglaublich kitschig finde, was Ma gerade sagt. Zum anderen, weil ich mich wie ein Häufchen Elend fühle und nicht wie die Kämpferin, die sie in mir sieht.
»Du bist mir so unglaublich ähnlich«, sagt sie und hat dieses gewisse Lächeln, das immer auch eine Traurigkeit verbirgt, denn sie ist nicht meine leibliche Mutter und auch erst meine Ma, seit ich ungefähr drei war.
»Aber Lu, du musst nicht alle Kämpfe allein austragen, hörst du?«
Und damit beugt sie sich zu mir, drückt mich fest an sich und gibt mir einen Kuss auf die Stirn. Hält mich noch einen Moment in ihren Armen, ehe sie von der Couch aufsteht und wieder meine souveräne Anwaltsma ist.

Die Matheübungen habe ich längst aufgegeben, liege erschöpft in meinem Bett. Ich sollte weiter lernen, aber ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wofür ich trigonometrische Funktionen jemals wieder brauchen werde. Ich bezweifle sehr stark, dass der Mist nach dem Abschluss nützlich ist, geschweige denn, dass ich je wieder davon hören werde. Lieber schaue ich durch das Dachfenster. Die Feuchte des Herbstes liegt darauf und dahinter verbergen Wolken die Sterne. Wegen der Schreibtischlampe, die etwas Licht ins Zimmer wirft, kann ich eine Reflexion von mir im Fenster sehen. Störend. Etwas, das da nicht hingehört.
Ich denke so lange darüber nach, dass ich mich schließlich auf die Seite drehen muss, um meine Gedanken zu unterbrechen und nicht wieder in einer Welle aus Selbsthass zu ertrinken. Beim Umdrehen berühre ich versehentlich mein Smartphone und es leuchtet auf. Mona hat geschrieben. Allerdings nicht mir, sondern in der Trainingsgruppe. Auf meine Nachrichten reagiert sie schon ewig nicht mehr. Mit einem Finger schiebe ich das Handy langsam in Richtung der Bettkante. Dem Abgrund entgegen, bis es schließlich mit einem Rumpeln auf dem Teppichboden landet. Mein Blick fällt auf meine Tasche, die ich heute in der Schule dabeihatte, und ich richte mich auf. Das Notizbuch.
Ich ziehe die Tasche heran und das Buch, das ich gefunden habe, fällt heraus. »Welcome to my Ghost World«, begrüßt es mich wieder, als ich es aufschlage. Kurz verweile ich auf der ersten Seite. Sie gefällt mir. Die Schrift, die wunderschönen Verzierungen, das kleine Gespenst. Die vielen Details. Und dass es schwarz ist. Ich weiß, das reinste Klischee, aber was soll’s?
Vorsichtig blättere ich auf die nächste Seite. Es zeigt eine Frau, die sich ihren Pullover über den Kopf zieht. Die Linien sind fein, der BH und der Pullover der Frau schwarz, ihre Haut weiß, mit linierten Schattierungen.
Auf der nächsten Seite verschiedene Versuche von Händen, auf der Seite danach Augen und Lippen. Alles mit einem schwarzen Stift gemalt. Es folgt eine nackte Frau, die auf einer Wiese zwischen Totenschädeln sitzt. Ein Arm verdeckt ihre Brüste, der andere verschwindet zwischen ihren Schenkeln. Ihr Gesicht scheint zu den Schädeln zu blicken, doch es ist von ihren Haaren verdeckt. Viele, viele einzelne Linien.
»Dir gefallen die Zeichnungen.«
Der Schreck zuckt durch mich, wie ein Blitz. Ich kann die Beine nicht schnell genug aus dem Schneidersitz befreien,
während ich gleichzeitig aufspringen will und rutsche ungeschickt vom Bett. Lande neben meinem Smartphone. Mein Po schmerzt.
»Was zur Hölle?« Meine Stimme ist schrill und laut und klingt kein bisschen nach mir.
Am Fußende neben meinen Mathehausaufgaben sitzt eine dunkelhaarige Fremde, etwa in meinem Alter und hat überrascht den Mund geöffnet.
»Du kannst mich hören?«, fragt sie verdutzt.
Ich packe die Glasflasche auf meinem Nachttisch, das einzig Greifbare, was einer Waffe am nächsten kommt.
»Was machst du in meinem Zimmer?«, blaffe ich die Fremde an. Sie sitzt einfach da, in ihrem gestreiften Oberteil und der Stoffhose, schiebt sich ihre langen dunklen Haare hinters Ohr. Nichts an ihr ist wunderlich, außer der Tatsache, dass ich sie nicht kenne und sie einfach so in meinem Zimmer aufgetaucht ist. Sie sieht sich um, betrachtet den Raum, als sei ihr bis zu diesem Moment nicht klar gewesen, dass sie hier ist.
»Wie bist du hier reingekommen?«
Sie macht keine Anstalten zu antworten, betrachtet mit ihren dunklen Augen einfach jedes Detail meines Zimmers. Ich nutze den Moment und mache vier schnelle Schritte zur Tür, reiße sie auf und schreie nach meiner Ma.
»Du sollst nicht durchs Haus schreien«, ruft sie von unten zurück. Aber ich kann hören, dass sie sich nähert.
Noch immer sitzt die Fremde nur da, betrachtet nachdenklich das Notizbuch, das ich noch in der Hand halte.
»Woher hast du das?«, fragt sie schließlich.
Im selben Augenblick steht Ma in der Tür, eine kleine Falte zwischen den Brauen.
»Du sollst nicht so durchs Haus brüllen«, wiederholt sie zum tausendsten Mal. Offenbar steht mir die Angst ins Gesicht geschrieben, denn direkt danach fragt sie: »Geht’s dir gut?«
Ma blickt auf die Flasche in meiner Hand. »Schon wieder eine Spinne?«
Mein Kopf zuckt in Richtung des Bettes. Ma sieht hin und mich dann wieder an.
»Wo ist sie?« Sie geht ein paar Schritte in den Raum, sieht sich um und scheint keine Kenntnis davon zu nehmen, dass da ein fremdes Mädchen auf meinem Bett sitzt.
»Keine Spinne«, hauche ich, an meinem Verstand zweifelnd.
»Was dann? Brauchst du Hilfe bei Mathe?«, hakt sie nach und geht zum Bett, um den Block in die Hand zu nehmen und sich mein Problem genauer anzuschauen. Ihre Hand gleitet direkt durch die Unbekannte, die dort sitzt, als sei sie aus Luft. Die Wasserflasche fällt mir aus der Hand und landet mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden.
»An welcher Aufgabe scheitert’s?«, fragt Ma und sieht mich an. »Meine Güte, Lu, was ist los?« Sie lässt die Sachen wieder aufs Bett fallen und kommt zurück zu mir. Packt mich bei den Schultern. »Du bist ganz blass.«
Die Unbekannte sitzt nur da, am Ende meines Bettes, und es scheint sie keineswegs zu stören, dass erst die Hand meiner Mutter und dann meine Mathesachen durch ihren Körper geglitten sind.
»Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.« Mas Hand landet auf meiner Stirn, um zu prüfen, ob ich Fieber habe.
»Hast du … ich bin … kannst du sie nicht –?«, stottere ich. Mein Gehirn ist voll darauf konzentriert, an Sauerstoff zu gelangen und nicht in Panik zu geraten.
»Lu, du machst mir Angst. Was ist los mit dir?«
»Mir geht’s nicht gut«, gebe ich zu und habe das Gefühl, dass meine Beine jeden Moment einfach in sich zusammenbrechen und mein Gewicht nicht mehr tragen können. Wie die kleinen dünnen Streichholzbeine einer Kastanienfigur.
Ma nimmt mir das Notizbuch ab, das ich noch immer halte und wirft es aufs Bett zu meinen Schulsachen. Der Blick der Fremden folgt dem Buch, bis in ihren Schoß, nur dass es nicht in ihrem Schoß liegen bleibt, sondern durch sie hindurch fällt.
Ich schnappe nach Luft.
»Komm, komm«, drängt Ma. Und schiebt mich aus dem Zimmer. »Dani, kannst du bitte Teewasser aufsetzen?«, ruft sie nach unten, trotz der nicht-durchs-Haus-schreien-Regel. Mich schiebt sie ins Badezimmer und drückt mich auf den Rand der Badewanne. Ohne mich zu lange aus den Augen zu lassen, greift sie nach einem Waschlappen, den sie nass macht und mir dann auf die Stirn drückt. Keine Ahnung, was genau das bewirken soll, aber ich weiß ja auch nicht, was die richtige Herangehensweise ist, wenn man gerade wirklich und leibhaftig einen Geist gesehen hat.
Kann das sein? Ein Geist?
Ich halte den Waschlappen an meine Stirn, als sei er alles,
was mich davon abhält, völlig zusammenzubrechen und schließe meine Augen.
»Ist dir Mamas Essen nicht bekommen?« Obwohl Ma versucht einen Witz zu machen, kann ich hören, wie besorgt sie ist.
»Weiß nicht«, gebe ich zu. Und das ist nicht mal gelogen. Vielleicht war wirklich was mit dem Essen nicht in Ordnung. Oder der Schlag von Wieber. Sehe ich deswegen jetzt fremde Menschen in meinem Zimmer? Ich reiße die Augen auf und sehe mich um, ob auch im Badezimmer irgendwelche Leute sind, die dort nicht hingehören.
Niemand da, außer Ma und mir.
»Vielleicht wirklich das Essen«, sage ich, als ich Mas
besorgten Blick wahrnehme. Daraufhin nimmt sie die Wärmflasche aus einer der Schubladen und zieht mich wieder auf die Beine.
»Los, ab auf die Couch mit dir«, bestimmt sie.
Sie lotst mich die Treppe herunter, als wüsste ich nicht, wie man diese benutzt und setzt mich auf die Couch, ehe sie in die Küche geht. Ein kurzer Wortwechsel zwischen meinen Müttern, den ich wegen des rauschenden Wasserkochers nicht verstehen kann und schon ist Mama mit der Wärmflasche da, zwingt mich, mich hinzulegen und legt sie mir auf den Bauch. Sie zieht gerade eine der Wolldecken über mich, als Ma mit dem Tee auftaucht.
»Mir geht’s gut«, sage ich, weil es mir nun doch langsam zu viel wird, so bemuttert zu werden.
»Hm«, brummt Ma und nun legt auch Mama kurz ihre Hand prüfend auf meine Stirn. »Ach mein Baby«, säuselt sie und lässt sich dann neben mir auf dem Sofa nieder, damit sie meinen Kopf streicheln kann. Ma stellt den Tee auf dem Tisch ab und setzt sich in einen der Sessel. Es riecht nach Pfefferminz. Im Fernsehen laufen Nachrichten und verkünden allabendlich den Tod und das Verderben auf diesem Planeten. Ich seufze und mache die Augen zu.
»Brauchst du die Magentropfen?«, fragt Mama.
Ich schüttele den Kopf. »Nein, nur kurz ausruhen. Geht gleich wieder.« Hoffe ich.
Erst durch die Hitze der Wärmflasche merke ich, wie kalt meine Finger sind. Ich denke darüber nach, was die bessere Option ist: Eine Lebensmittelvergiftung, die einen halluzinieren lässt oder tatsächlich Geister sehen zu können. Puh, keine leichte Entscheidung. Bei Ersterem sollte mir vermutlich der Magen ausgepumpt werden oder so was. Aber anders kann es doch nicht sein. Oder?
Mir dröhnt der Schädel, als hätte ich den ganzen Tag ohne Ohrenschutz neben einem Presslufthammer gesessen. Die Stimme der Nachrichtensprecherin macht es nicht besser. Ich würde lieber in meinem Bett liegen, wo ich meine Ruhe habe. Aber …
»Ma?«, frage ich leise und kann hören, wie sie sich in ihrem Sessel bewegt. »War in meinem Zimmer irgendwas Merkwürdiges?«
Kurzes Schweigen, vermutlich ein Blickaustausch meiner Mütter, dann fragt sie: »Außer der merkwürdigen Matheaufgaben? Nein, da war nichts Komisches.«
Ich muss lächeln. Gleichzeitig macht es mir Angst, was ich gesehen habe. Wen ich gesehen habe. Ist sie immer noch da? Wartet da oben auf mich, bis ich wiederkomme? Oh Mann, ich hoffe nicht.
Die Wärme unter der Wolldecke lullt mich ebenso ein wie das Gefasel aus dem Fernseher. »… Rat formuliert zum wiederholten Mal einen Verbotsantrag. Der städtischen Verwaltung soll damit das Gendern untersagt werden.«
Meine Gedanken werden wirr und wirrer, bis sie schließlich zu einem erschöpfenden Mix aus Wachsein und Träumen werden.
Eine nackte Frau, die ihren Kopf hebt und unter ihren Haaren taucht das Gesicht der Fremden auf. Buster, der meinen Teller leer isst und dann Durchfall im ganzen Haus verteilt. Meine Ma, die leise etwas zu Mama sagt. Mona, die lacht, als Wieber mir eine verpasst und mein Gesicht mit spitzen Schlüsseln zerkratzen will. Was er nur nicht schafft, weil meine Haare abreißen und in seinen Händen zu einem schlangenartigen Monster werden, das ihn verschlingt.
Ich schrecke auf.
Das Wohnzimmer ist dunkel, der Fernseher aus und meine Mütter vermutlich im Bett. Buster liegt an meinen Füßen, was er eigentlich nicht darf, aber wenn ich krank bin, können die beiden einfach nicht nein sagen. Ich setze mich auf, was ihm einen Schnarcher entlockt. Verschlafen streichle ich ihm den Kopf.
Bis auf die erschlagende Müdigkeit fühle ich mich besser. Ich nehme einige Schlucke vom Tee, der auf dem Tisch kalt geworden ist.
Es war Einbildung. So muss es sein. Oder wirklich eine Lebensmittelvergiftung oder so was. Es gibt eine Erklärung für das, was ich glaube, gesehen zu haben.
»Buster, wach auf«, flüstere ich und stupse ihn ein paar Mal sachte an.
Mag sein, dass ich mir alles eingebildet habe, trotzdem fühle ich mich sicherer, wenn der Hund mich nach oben begleitet. Er gähnt quiekend, schüttelt den Kopf, als wolle er die Müdigkeit damit loswerden und hüpft schließlich vom Sofa. Erwartungsvoll sieht er mich im Halbdunkel an. Ich stehe auf, wickle die Wolldecke um mich und hole tief Luft.
»Na dann mal los«, sage ich mehr zu mir als zu Buster. Mama hat im Flur eine der kleinen Lampen angelassen, damit ich nicht im Dunkeln die Treppe hoch muss. Buster trottet neben mir her. Es wäre mir lieber, er würde vorgehen und die Lage checken, aber ich befürchte, dafür taugt dieser treudoofe Mischling nichts.
Vor meinem Zimmer bleibe ich stehen und mache mich darauf gefasst, die Fremde wiederzusehen. Ich spähe durch die halbgeöffnete Tür, aber das spärliche Licht, das aus dem unteren Flur nach oben dringt, reicht gerade mal, um sich nicht an irgendeiner unliebsamen Ecke den Zeh zu stoßen.
Mit dem Fuß stoße ich sanft die Tür auf.
»Buster, such«, befehle ich und unser Hund blickt mich skeptisch an. Trotzdem tapst er ins Zimmer. Zwar checkt er nicht jeden Winkel des Raums, wie ich es gerne hätte, aber er springt aufs Bett und macht es sich dort bequem. Was wohl so viel heißt wie: alles safe.
Ich schalte das Licht an, um selbst nachsehen zu können. Und tatsächlich, das Zimmer ist leer, bis auf den Hund und mich. Ich schalte das Licht wieder aus und stakse zum Bett. Schiebe mich, noch immer in der Wolldecke eingewickelt, unter meine Bettdecke. Doppellagiger Sicherheits-Burrito. Busters Atem wird schnell schwer, wie unten auf dem Sofa, und ich schaue mir noch eine ganze Zeit die Sterne durchs Dachfenster an, die doch noch von den Herbstwolken freigegeben wurden, ehe auch ich endlich einschlafe.

»Geht’s dir besser?«, fragt Mama, als ich in die Küche schlurfe. Meine Antwort ist nur ein vages Brummen, denn ich fühle mich wie ein Turnschuh, der von Buster zerkaut wurde. Ich habe nicht besonders viel geschlafen. Bin ständig aufgeschreckt, wegen Albträumen oder der Angst, nicht mit Buster allein im Zimmer zu sein.
»Für die Schule wird’s reichen«, füge ich hinzu und lasse
mich auf einen der Küchenstühle fallen. Ich ziehe die dampfende Kaffeetasse zu mir, die eigentlich für Ma auf dem Tisch steht, aber Mama lässt mich gewähren.
»Es steht also nichts Wichtiges an?«, hakt sie nach und holt eine neue Tasse aus dem Schrank.
Ich zucke mit den Schultern. »Nichts weiter als das übliche hohle Getue der Erich-Kästner-Gesamtschule, mit all ihren blasierten Schüler*innen und einem so staubig-antiquierten Lehrkörper, dass man ihn wegpusten könnte, wenn man wollte. Aber darf man nicht, denn dann heißt es sofort, man sei unehrerbietig. Denn das ist alles, was den Autoritäten teuer ist: Dass ihnen Respekt entgegengebracht wird. Während sie selbst nicht mal wissen, wie man das Wort schreibt, geschweige denn, wie man jüngeren Generationen etwas davon entgegenbringt. Und eine Matheklausur.«
»Das sind ziemlich viele große Wörter so früh am Morgen«, sagt Ma, die gerade in die Küche kommt und unmittelbar Kaffee in die neue Tasse gießt, die an ihrem Platz steht.
»Ist es mit Mona wenigstens wieder besser?«, fragt Mama und beißt in ihren Bagel mit Frischkäse.
Ich verziehe den Mund, was mit einem ziehenden Schmerz quittiert wird. »Ich hab’ keinen Bock mehr auf sie.«
Meine Mütter werfen sich einen dieser Blicke zu.
»Was?«, hake ich nach.
»Nichts«, sagen sie beide sofort und beschäftigen sich mit ihrem Frühstück. Als wüsste ich nicht, dass sie anderer Meinung sind als ich.
Ich schnaube und nehme einen weiteren Schluck Kaffee. »Es ist besser so.«
Und die meiste Zeit glaube ich das wirklich.
Mona und ich … das ist einfach nicht mehr, was es mal war.
Irgendwann sind unsere Wege in verschiedene Richtungen weitergegangen. Best friends forever am Arsch. So ist das wohl im Leben. Man geht zusammen zum Kindergarten, klebt sich nach dem Skateboard fahren Pflaster auf die aufgeschlagenen Knie, verbringt jeden Tag der Sommerferien zusammen im Freibad und zeltet, knüpft sich Freundschaftsarmbänder, lernt gemeinsam für alle Klausuren und schimpft auf die Lehrkräfte und die Noten. Und dann kommt so ein Chauvi-Arsch wie Wieber daher und auf einmal ist das alles vergessen.
Ich schnappe mir eins der veganen Croissants, als ich vom Tisch aufstehe. Buster folgt mir schwanzwedelnd nach oben, in der Hoffnung, etwas von dem Gebäckteilchen abzubekommen. Zum Trost, dass ich es nicht mit ihm teilen werde, kraule ich ihn einen Moment hinter den Ohren. Der Blick auf die Uhr sagt, dass ich spät dran bin, also schnappe ich mir meine Mathesachen, weil ich vor der Schule unbedingt noch mal reinschauen sollte, und werfe sie in meine Tasche. Etui, das gefundene Notizbuch, Kopfhörer und das Handy, auf dem nun wieder Monas Nachricht aufleuchtet.
»Ja, gleich«, denke ich und manövriere mich am immer noch auf einen Snack hoffenden Buster vorbei.
Zurück in der Küche lasse ich einen Apfel in meine Tasche fallen, schnappe mir ein zweites Croissant und werfe meinen Müttern beim Rausgehen einen Luftkuss zu. »Bis später.«
»Wenn es dir schlecht geht, dann melde dich«, ruft Mama mir noch nach. Und schon bin ich draußen und stehe im Halbdunkel eines weiteren Tages, der verspricht genauso grau und feucht wie der vorherige zu werden. Die morgendliche Kälte des Novembers begrüßt mich wie eine alte Freundin.
Während ich das Croissant esse, öffne ich auf dem Handy
den Nachrichtenverlauf von Mona und mir. Wobei es eigentlich nur noch Nachrichten von mir sind.
Hast du Zeit?
Telefonieren?
Wollen wir ins Kino?
Wie geht’s dir?
Hallo?
???
Alle gelesen, aber nie von Mona beantwortet. Warum weiß ich nicht. Wenn wir uns in der Schule mal über den Weg laufen, redet sie ganz normal mit mir, tut fast so, als sei alles wie immer. Nach der Schule ist es, als existiere ich für sie nicht mehr. Es fällt mir leicht zu denken, dass Wieber
etwas damit zu tun hat. Es sticht im Herz, zu wissen, dass –
ob Wieber über mich herzieht oder nicht – er ihr mittlerweile wichtiger ist. Seit letzten Sommer sind sie zusammen, aber verknallt ist sie schon seit der zehnten Klasse in ihn. Mann, wie viele Nächte habe ich neben ihr im Bett gelegen und mir angehört, wie toll er doch ist? Habe gedacht, das vergeht schon wieder, vorsichtig darauf hingewiesen, was er für problematisches Zeug von sich gibt. Nützte alles nichts. Ganz im Gegenteil, sie ist sogar immer häufiger sauer auf mich geworden, wenn ich Kritik geäußert habe.
Der Stich wird zu Schmerz und breitet sich in mir aus. Hüllt meinen ganzen Körper in diese beengende und bedrückende Melancholie.
Ihr gegenüber ist er natürlich immer der perfekte Gentleman. Charmant und lustig. Ich sehe es, wenn ich die beiden beobachte. Trotzdem hatte ich gedacht, dass das Band zwischen Mona und mir stärker ist. Dass es nicht sofort reißt, sobald sich eine von uns verliebt.
Eine kleine Stimme in mir flüstert, es liegt an mir, es sei meine Schuld. Ich gehe etwas schneller, als könnte ich ihr so davonlaufen. Aber weil ich weiß, dass ich dieser Stimme nicht entkommen kann, suche ich in meiner Tasche gleichzeitig nach den Kopfhörern. Jetzt hilft nur noch Musik. Ich schiebe den Rest des Croissants in den Mund, um besser in der Tasche wühlen zu können.
Trotzdem rutscht mir schließlich der Riemen von der Schulter. Ich bekomme ihn nicht schnell genug zu fassen und die Tasche samt Inhalt landet auf der Straße.
»Mist«, fluche ich und bücke mich, um die Sachen aufzusammeln. Als ich mich aufrichte, steht sie vor mir. Unwillkürlich mache ich einen Schritt rückwärts.
»Hi«, sagt die Fremde, die schon gestern in meinem Zimmer saß, und lächelt freundlich.
»Oh nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein.« Ich sehe mich kurz um, prüfe, wo ich bin und gehe dann zügig in eine Richtung, die zwar ein Umweg zur Schule ist, aber mich weg von der unheimlichen Fremden führt.
»Bitte warte«, sagt sie hinter mir, aber ich fingere schon eifrig an den Kopfhörern, um endlich jegliche Stimmen verbannen zu können.
»Das ist nicht echt, das ist nicht echt, das ist nicht echt«, bete ich mantraartig herunter.
Als ich die Kopfhörer endlich auf den Ohren habe, verkünden sie mit einem kläglichen Geräusch, dass ihr Akku leer ist.
»Wollt ihr mich verarschen?«, zische ich gereizt und gehe noch schneller in der Hoffnung, die Fremde abhängen zu können. Ich traue mich nicht über die Schulter zu gucken, ob sich der Abstand zwischen uns tatsächlich vergrößert. Einfach ignorieren, dann wird sie schon wieder verschwinden.
Ich frage mich ernsthaft, ob die Prügel von Wieber irgendwas in meinem Hirn kaputt gemacht haben, weswegen ich nun halluziniere?
Schöne Scheiße.
Mir brennt die Lunge vom hastigen Gehen und der kalten Luft, aber erst als ich endlich die Schule sehen kann, entspanne ich mich ein wenig. Was merkwürdig ist, denn ein Gefühl der Erleichterung hat die Schule selten in mir ausgelöst.
Als das Gebäude nur noch so weit entfernt ist, dass ich sie mit einem kleinen Sprint erreichen könnte, traue ich mich endlich, mich umzusehen.
Niemand da. Erleichtert atme ich aus.
Bis auf das Licht auf den Fluren liegt noch alles im Dunkeln. Die Lehrpersonen, die schon da sind, sitzen im Kollegiumszimmer, andere Schüler*innen sind bisher kaum zu sehen.
Zielstrebig gehe ich zur Schulbücherei. Ich müsste eigentlich erst zur ersten Pause wieder dort sein, aber ich hoffe, dass bisher niemand mein Chaos vom Vortag entdeckt hat und ich es noch beseitigen kann.
Wie erwartet finde ich die Bücherei abgeschlossen vor und das Durcheinander ist unverändert. Wenn mich schon Geister besuchen, warum dann keine, die mein Chaos aufräumen?
Ich lege meine Sachen ab und mache mich daran, Bücher zurück ins Regal zu stellen. Buch für Buch merke ich, wie unwohl ich mich fühle, weil ich mit dem Rücken zur Tür arbeiten muss. Dieser verdammte Wieber. Ich habe noch nie erlebt, dass für ihn etwas schon mal so richtig Konsequenzen hatte. Außer vielleicht seine schlechten Noten, denn immerhin wiederholt er die Zwölfte jetzt zum zweiten Mal. Da hat wohl auch Papi Stadtrat nichts mehr machen können. Aber davon abgesehen … als er vorletztes Jahr fast den Chemieraum in die Luft gejagt hat, weil er nicht auf Frau Schriek gehört und einfach irgendwelche Substanzen gemischt hat – ein paar Mal nachsitzen und das war’s. Dank eines dicken Schecks seiner Eltern. Nicht mal als Tim beide Schneidezähne verloren hat, weil Wieber es für lustig gehalten hat, ihn auf der Treppe zu schubsen und Tim dann gestürzt ist, gab es nennenswert Ärger für ihn. Mit allem kommt er davon.
Auf dem Flur sind Schritte zu hören und ich fahre angespannt herum. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Wieber nicht ambitioniert genug ist, um früher zur Schule zu gehen, als er muss, und versuche mich wieder zu entspannen, nachdem die Schritte verklungen sind.
Ich muss mich heute einfach möglichst in der Nähe von anderen Menschen aufhalten, damit er mir nicht auflauern kann. Nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, meine Zeit in der Nähe von anderen Menschen zu verbringen, aber es wird schon gehen.
Als ich fertig bin, habe ich noch immer gut fünfzehn Minuten bis zur ersten Stunde. Ich sollte wohl Mathe lernen, stattdessen ziehe ich das Notizbuch aus der Tasche. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir gut. Die Zeichnungen sind wunderschön und gleichzeitig grotesk. Sie wirken wie Skizzen, dabei steckt so viel mehr in ihnen. An die warme Heizung gelehnt, lege ich meinen Schal neben mich und das Buch auf meine angewinkelten Beine.
Welcome to my Ghost World.
Der nackten Frau mit den Schädeln, die ich schon gestern bewundert habe, folgen weitere gesichtslose Menschen. Meistens Frauen, manchmal auch Männer. Alle im gleichen Stil und ausschließlich schwarz auf weiß. Oft begleitet von Krähen, Geistern oder Skeletten; vielen eher morbiden Details, die meiner dunklen Seele besonders gefallen.
Ich blättere weiter, wundere mich über den Rest einer herausgerissenen Seite, staune über die filigrane Zeichnung einer Rose, verliebe mich in eine Seite voller Motten und werde schließlich überrascht von einer Zeichnung, die vor Farbe geradezu explodiert.
Sie ist anders als die vorherigen, nicht nur, weil sie bunt ist. Der Zeichenstil ist anders. Weniger grob und skizzenhaft, stattdessen sieht mich das Portrait einer jungen Frau an, die der Fremden ähnlich sieht. Mit dunklen Augen, lachend und mit wallendem Haar, das ihr über die Schultern fällt. Auf dem Kopf eine Krone, wie die von Loki aus den Marvel-Filmen. Sie trägt ein grünes Kleid. In der einen Hand hält sie eine übergroße Häkelnadel, in der anderen ein Stück Kuchen. Auf ihrer Schulter sitzt ein Chamäleon, das sich kein bisschen der Umgebung angepasst hat. Am Himmel hinter ihr stehen gleichzeitig die Sonne und der Mond und drumherum ein paar Sterne. Einige fallen vom Himmel, verfangen sich in ihren Haaren, oder liegen auf dem Boden im Gras, zwischen Laub und Musiknoten, Klee und Bienen.
Darunter steht: the strength, the love, the power.
Als die Tür zur Bücherei aufschwingt, zucke ich heftig zusammen. Das Buch rutscht von meinem Schoß und landet zugeschlagen auf dem Boden.
Monas rotblonder Lockenkopf erscheint und sie blickt unsicher herein. Als sie mich entdeckt, bekommt sie große Augen. Ich ziehe meine Ärmel über die Handgelenke, verstecke die Armbänder darunter.
»Ach du Scheiße«, entfährt es ihr. Sie schließt die Tür hinter sich. Mit besorgtem Gesicht kommt sie auf mich zu, als seien wir noch immer die besten Freundinnen seit dem Kindergarten. Unschlüssig steht sie vor mir. »Was ist passiert?«
»Bin gestürzt«, sage ich gereizter als beabsichtigt. Den Teufel werde ich tun und ihr erzählen, was ihr Freund getan hat. Sie wird es mir eh nicht glauben. Ich habe keine Lust, dass sie mich mit diesem Blick ansieht. Dieser Blick, der zusammen mit Wieber in mein Leben gekommen ist: Skepsis. Als würde ich ihr ihre Gefühle nicht gönnen oder so was. Natürlich gönne ich es ihr, glücklich zu sein. Wirklich. Ich kann nur einfach nicht begreifen, warum die liebe und kluge Mona unbedingt an Wiebers Seite ihr großes Glück vermutet. Ich habe längst aufgegeben zu versuchen, sie auf seine sadistische Seite aufmerksam zu machen. Und sie hat lange daran gearbeitet, immer im richtigen Moment wegzusehen, damit ihr Bild von Wieber nicht zerspringt. Ähnlich wie Mathe verstehe ich auch das nicht. Und das war quasi der Anfang vom Ende. Sie wollte nicht mehr hören, was ich über Wieber zu sagen habe und ich wollte nicht hören, wie er ihrer Meinung nach wirklich ist.
In Monas Gesicht passiert etwas, das ich nicht lesen kann. Früher konnte ich das immer. Sie geht vor mir in die Hocke.
»Steht dir gut«, sagt sie und versucht sich an einem versöhnlichen Lächeln. »Der neue Haarschnitt«, fügt sie hinzu, um mir direkt die Luft für eine spitze Bemerkung zu nehmen.
Ich verziehe meinen Mund, glaube aber nicht, dass es als Lächeln durchgeht. Aber die verletzte Lippe entschuldigt das.
Ich glaube, sie weiß es. Ich glaube, tief in ihr weiß Mona ganz genau, was Wieber für ein Kerl ist. Bekommt manche seiner Kommentare mit. Überhört sie, als sei es keine Absicht von ihm. Und ich halte rein gar nichts von ihm, aber das muss man ihm lassen: Er hat ein großes Talent dafür, den Leuten ein gewisses Bild von sich in den Kopf zu pflanzen. Und hasst Leute, wie mich, bei denen das nicht funktioniert.
Dennoch sollte man doch meinen, dass gut vierzehn Jahre Freundschaft etwas mehr Gewicht haben würden. Dass Mona weiß, dass ich nie etwas Schlechtes für sie will und nur deswegen nicht ertrage, dass sie mit Wieber zusammen ist.
Ich sehe sie an und obwohl ich ihr Gesicht kenne, schon so lange kenne, ist es mir beinahe fremd. Sie ist direkt vor mir und trotzdem ist das Gefühl des Vermissens so stark, als wäre sie auf einem anderen Planeten.
»Für immer und ewig«, erinnere ich mich. Unser Lachen, als wir uns gegenseitig die Freundschaftsbändchen umbinden.
Die Bändchen, die nun beide an meinem Handgelenk hängen und auf der Haut brennen. Mein Herz schlägt, aber es fühlt sich an, als sei es eingeschnürt. Mit jeder Erinnerung an Geburtstage, Sommerferien, Kaufhausbesuche, geschwänzte Sportstunden und Filmabende wird mir klarer, dass keine neuen Erinnerungen mehr dazukommen. Und die Schlingen um mein Herz werden enger und enger.
Mona wirkt, als wolle sie etwas zur Situation sagen. Doch sie richtet sich auf. Holt stattdessen ihren Rucksack hervor und zieht ein Buch raus. »Wollte das zurückgeben.«
Sie wackelt mit einer Ausgabe von »Ich werde immer da sein, wo du auch bist« vor meinem Gesicht und ich will fast lachen, so ironisch ist das. Aber ich raffe mich auf und nehme ihr das Buch ab. Am Schreibtisch mit dem Computer ziehe ich die Karte vom Buch aus der Karteikartenkiste. Mona steht da und schaut zu. Es nervt mich. Sie strahlt so sehr aus, dass sie nicht mehr hier sein will, es ist nicht auszuhalten.
»Musst mir nicht zusehen«, gebe ich grummelnd von mir und sie lächelt erleichtert.
»Wir sehen uns«, sagt sie, als sie bereits an der Tür ist. Dann ist sie weg und die Tür fällt hinter ihr zu.
»Als ob«, flüstere ich und schlucke das bittere Gefühl herunter. Versuche es zu ignorieren, wie schon so lange. Ich starre auf die Karte, auf Monas Namen. Brauche einen Augenblick, bis ich schließlich das heutige Datum ans Ende der Zeile schreibe und die Karte in das Buch stecke.
Es landet auf dem Stapel mit den Büchern, die ich als Nächstes digitalisieren will. Auf den Fluren wird es lauter und die Uhr über der Tür verrät, dass es bald Zeit für die Matheklausur ist.
Ich seufze schwer, klaube das Notizbuch auf, um es in meine Tasche zu stecken. Als ich mich umdrehe, um noch meinen Schal zu holen, strauchle ich vor Schreck rückwärts und werfe dabei einen der Stühle um.
»Verdammte Scheiße!«, fahre ich die Fremde erschrocken an.
»Bitte lauf nicht weg«, sagt sie flehend.
»Was willst du von mir?«, frage ich laut.
Sie macht einen Schritt auf mich zu, nicht bedrohlich, trotzdem weiche ich vor ihr zurück, um den Abstand zu wahren. »Sag mir, warum du mich verfolgst.«
Die Fremde wirkt unglücklich, hat eine Falte auf der Stirn. Während ich sie beobachte, bekomme ich den Eindruck, dass sie darauf keine Antwort weiß.
Schließlich räuspert sie sich und sagt: »Das Notizbuch. Ich glaube, es ist meins.«
Ihr Blick huscht zu meiner Tasche, in dem das Buch steckt.
»Dann nimm’s halt, aber lass mich in Ruhe«, entgegne ich gereizt und reiße das Buch heraus, schleudere es ihr entgegen. Erwarte, dass sie es fängt. Doch sie zuckt nicht mal, als das Buch einfach durch sie hindurch gleitet. Es donnert gegen den Heizkörper, ehe es auf den Boden neben meinen Schal fällt.
»Das kann nicht sein«, rede ich mir gut zu und weiche weiter von ihr zurück. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht.
»Wer bist du?«
»Ich … ich weiß es nicht.« Sie sieht unglücklich aus, als sie das sagt und für einen Moment flammt tatsächlich Mitleid in mir auf.
Ich sehe zum Notizbuch, das hinter ihr liegt. Drei Schritte und ich hätte es zurück und könnte abhauen.
»Bitte«, sagt sie, als hätte sie meine Überlegung gehört. »Ich brauche deine Hilfe.«
Ich fahre mir mit der Hand durch die kurzen Haare. »Das kann doch nicht sein.«
Scheiß auf das Buch und den Schal. Ich packe meine Tasche und wende mich der Tür zu. Kopfschüttelnd, vor mich hinmurmelnd.
»Ich träume. Oder halluziniere. Das ist nicht echt, das ist nicht echt, das ist nicht echt.« Ich kann einfach nicht glauben, dass sie … ein Geist sein soll? Das kann nicht sein.
»Bitte lauf nicht weg«, höre ich sie hinter mir. »Du bist die Einzige, die mich sehen und hören kann.«
»Na wunderbar«, entfährt es mir voller Sarkasmus. Trotzdem drücke ich die Klinke herunter und verlasse die Bücherei. Ich drehe mich nicht um, prüfe nicht, ob sie mir folgt. Mit schnellen Schritten gehe ich zum Treppenhaus und ins obere Stockwerk. Der Unterricht hat längst begonnen und ich kann mir sicher sein, dass ich einen herrlichen Anschiss von Jablonski bekommen werde.

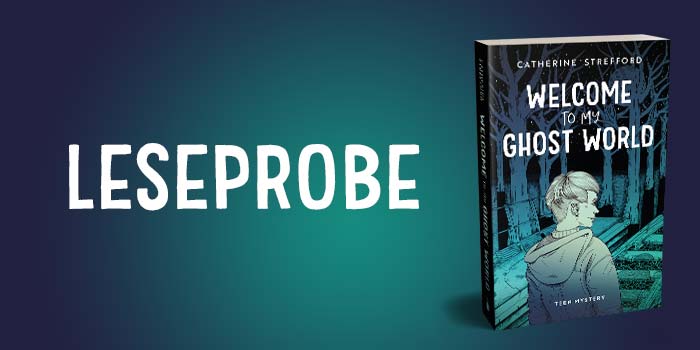
Schreibe einen Kommentar